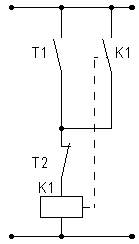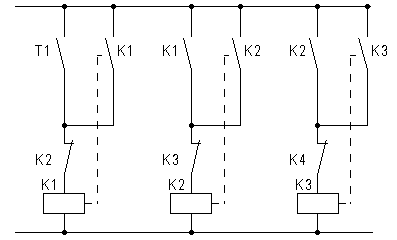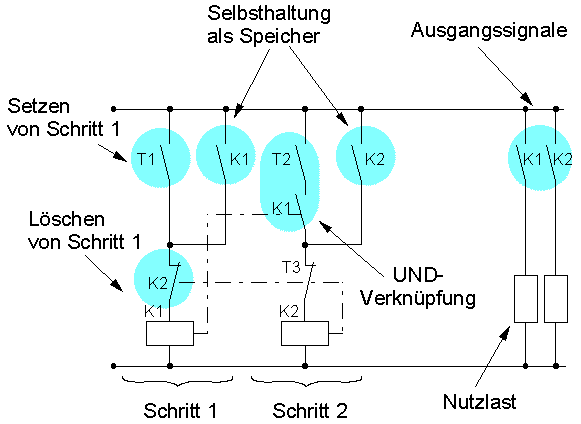Steuerungstechnik - Informationsmaterial
Taktsteuerungen mit Relais
| Hinweis Dieser Abschnitt soll Sie darüber informieren, wie Sie mit Hilfe von Relais nach einem bestimmten Schema eine Taktsteuerung bzw. Taktkette entwickeln können. Taktketten sind besonders gut zur Steuerung von Prozessen geeignet, in denen einzelne Arbeitsschritte streng nacheinander ausgeführt werden sollen. Auch für komplexe Abläufe mit einer großen Anzahl von Prozeßschritten oder vielen nacheinander anzusteuernden Pneumatikzylindern lassen sich so auf überschaubare Weise geeignete Steuerungen entwickeln.
Das Funktionsprinzip von Relais-Taktsteuerungen Das Relais ist eines der wichtigsten Bauelemente im Bereich elektropneumatischer Steuerungen. Relais werden zum Schalten als Öffner und Schließer eingesetzt oder dienen als Speicherbausteine. Einer speziellen Relais-Grundschaltung kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Relais mit Selbsthaltung. Am einfachsten läßt sich das Funktionsprinzip anhand des Schaltplans erklären (Bild 1).
Bild 1, Relais mit Selbsthaltung
Mit Hilfe dieser Grundschaltung ist es möglich, eine Ablaufsteuerung zu entwickeln. Dafür benötigt man genau so viele Relais (Speicher) wie die Anzahl der benötigten Prozeßschritte. Der Grundgedanke dabei ist, daß sich die Relais nacheinander einschalten und jedes eingeschaltete Relais den vorherigen Speicher wieder ausschaltet. Wie das funktionieren soll, zeigt Bild 2.
Bild 2, Taktspeicher in Reihe
Im obigen Bild sind nur die ersten 3 Relais dargestellt, die Verkettung könnte jedoch beliebig lang sein. Sie können erkennen, wie die Relais miteinander verknüpft sind, um die Taktschritte zu realisieren. Das Problem in der oben angegebenen Schaltung ist, daß die einzelnen Speicher nach Betätigung von T1 einfach bis zum letzten Relais durchschalten. In der Praxis sollen die Prozeßschritte jedoch nur dann ausgeführt werden, wenn z.B. ein Zylinder in der Endlage angekommen ist und ein Endlagenschalter betätigt wird. Die einzelnen Taktspeicher sollen also immer dann aktiviert werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
Weiterschaltbedingungen lassen sich als logische Verknüpfungen in die Schaltung einbauen. Zu diesem Zweck können parallel oder in Reihe geschaltete Öffner und Schließer eingesetzt werden. Am Beispiel einer zweistufigen Taktsteuerung sollen die Zusammenhänge beschrieben werden (Bild 3). Im folgenden Beispiel bildet das Relais K1 den ersten und K2 den zweiten Taktspeicher. Ein Zyklus des Relais-Schaltwerkes läßt sich wie folgt beschreiben:
Bild 3, Taktsteuerung für 2 Schritte Achtung: Um längere Taktketten aufzubauen, benötigt man Relais mit 4 Wechslern, wenn man das Taktkettenprinzip konsequent anwenden will:
Sie können das Taktkettenprinzip jedoch auch zum Schaltungsentwurf nutzen und anschließend Relais-Schalter einsparen, so daß nur 3 Wechsler (Steckrelais nach PAL, BIBB) benötigt werden. Man kann ggf. auf einige Schließer für UND-Verknüpfungen verzichten. Dann muß jedoch sichergestellt sein, daß der Signalgeber in dem Strompfad ohne UND-Verknüpfung nur dann betätigt werden kann, wenn dieser Taktschritt auch erfolgen soll. Wichtig: Steuerstromkreis u. Laststromkreis sind immer getrennt zu halten!! |
|||||||||||||
[zurück]
(c) Manuel Diegmann. Letzte Änderung: 24.07.99